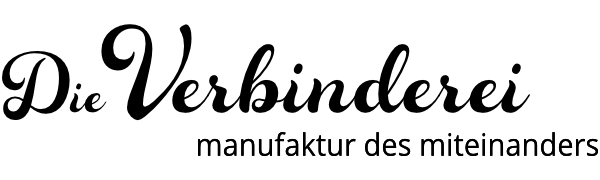15 Nov. Versatzstück 20131115
Hannah Arendt
___
Menschen, die eine Unterscheidung gesetzt haben
Ist es falsch, zu sagen, dass viele der Gedanken von Hannah Arendt nie so richtig Fuß gefasst haben? Und dass dies auch seinen Grund hat in der Aufmerksamkeit, die ihr zukam, durch ihre Berichterstattung über den Eichmann-Prozess, wo ihr vorgehalten wurde, Eichmann auf den Leim gegangen zu sein?
Das mag sein. Hier sollen zwei Aspekte hervorgehoben werden, die im Vergleich eine geringere öffentliche Beachtung gefunden haben, aber zumindest an dieser Stelle von Bedeutung sind. Es geht um Fragen in der Beziehung zwischen Macht und Gewalt und zur Unabwendbarkeit des Anfangs im Werk von Hannah Arendt.
Doch zuvor einige Daten zu Hannah Arendt. Sie wurde 1906 in Linden (bei Hannover) geboren. Sie studierte Philosophie, Theologie und Philologie bei Martin Heidegger, Edmund Husserl und Karl Jaspers. 1933 flieht sie aus Berlin nach Paris und von dort emigriert sie 1941 in die USA. 1951 erscheint ihr politisches Hauptwerk „Origins of Totalitarianism“ und 1960 ihr philosophisches Hauptwerk „Vita activa“. Sie bekommt Professuren in New York und Chicago und übernimmt für die Zeitschrift „New Yorker“ die besagte Berichterstattung über den Eichmann-Prozess. 1970 veröffentlichte sie die Studie „Macht und Gewalt“.
Wie definiert Hannah Arendt das Verhältnis von Macht und Gewalt? Sie beginnt bei dem Begriff des Handelns. Jedes Handeln bricht, gemäß Ihrer Vorstellung, durch Worte und Taten in ein bereits vorhandenes Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten ein. In diesem Bezugsgewebe, in dem Raum zwischen Menschen, konstituiert sich Macht. Macht kommt nicht – wie so oft erwähnt – einem einzelnen Akteur zu. Macht entsteht und verteilt sich zwischen Menschen im Netzwerk ihrer Beziehungen, wenn sie zusammen handeln. Erst Macht macht gemeinsames Handeln möglich – womit keine Aussage darüber getroffen ist, wie lebensdienlich sich dieses gemeinsame Handeln darstellt.
Die gelebte Macht findet ihre Grenze, wenn das aufeinander bezogene Handeln endet. Gewalt kann eine vorübergehende Bezogenheit aufeinander erzwingen. Wie sich an der begrenzten Lebensdauer gewaltsamer Regime aber zeigt, zerstört Gewalt letztendlich Macht.
„Nackte Gewalt tritt auf, wo Macht verloren ist. […] Man kann Macht durch Gewalt ersetzen, und dies kann zum Siege führen, aber der Preis solcher Siege ist sehr hoch; denn hier zahlen nicht nur die Besiegten, der Sieger zahlt mit dem Verlust der eigenen Macht.“ – Hannah Arendt
Gewalt ist somit kein Ausdruck von Macht. Sie ist ein Ausdruck von Ohnmacht. Die Androhung von Gewalt kann Macht begleiten. Sie kann in Räumen abseits der von den Beteiligten akzeptierten Art und Weise des Umgangs zum Einsatz kommen, um den gewollten Raum und die gewollte Art und Weise der Bezogenheit aufeinander zu schützen. So ist es im Fall des staatlichen Gewaltmonopols. Es hat für die Mitglieder einer Gesellschaft so lange eine nutzbringende Struktur, solange sie es in dieser Form und Funktion anerkennen und es aus ihrem Bereich der täglichen Verrichtungen ausschließen. Freiheit, das ist für Hannah Arendt, die Anteilnahme an öffentlicher Macht.
Menschen haben die Macht einen Anfang zu machen. Sie machen ihn zwangsläufig schon im Moment ihrer Geburt. Zu diesem zweiten hier ausgewählten Punkt schreibt sie in ihrem Werk „Vita activa“:
„Sprechend und handelnd schalten wir uns in die Welt der Menschen ein, die existierte, bevor wir in sie geboren wurden, und diese Einschaltung ist wie eine zweite Geburt, in der wir die nackte Tatsache des Geborenseins bestätigen, gleichsam die Verantwortung dafür auf uns nehmen. […] Die Anwesenheit von Anderen, denen wir uns zugesellen wollen, mag in jedem Einzelfall als ein Stimulans wirken, aber die Initiative selbst ist davon nicht bedingt; der Antrieb scheint vielmehr in dem Anfang selbst zu liegen, der mit unserer Geburt in die Welt kam, und dem wir dadurch entsprechen, dass wir selbst aus eigener Initiative etwas Neues anfangen. In diesem ursprünglichsten Sinne ist Handeln und etwas Neues Anfangen dasselbe; […] Weil jeder Mensch auf Grund des Geborenseins ein initium, ein Anfang und Neuankömmling in der Welt ist, können Menschen Initiative ergreifen, Anfänger werden und Neues in Bewegung setzen. […] Die Tatsache, dass der Mensch zum Handeln im Sinne des Neuanfangens begabt ist, kann daher nur heißen, das er sich aller Absehbarkeit und Berechenbarkeit entzieht, dass in diesem Fall das Unwahrscheinliche selbst noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, und dass das, was rational, d.h. im Sinne des Berechenbaren, schlechterdings nicht zu erwarten steht, doch erhofft werden darf. Und diese Begabung für das schlechthin Unvorhersehbare wiederum beruht ausschließlich auf der Einzigartigkeit, durch die jeder von jedem, der war, ist oder sein wird, geschieden ist, wobei aber diese Einzigartigkeit nicht so sehr ein Tatbestand bestimmter Qualitäten ist oder der einzigartigen Zusammensetzung bereits bekannter Qualitäten in einem Individuum entspricht, sondern vielmehr auf dem alles menschliche Zusammensein begründenden Faktum der Natalität beruht, der Gebürtlichkeit, kraft derer jeder Mensch einmal als ein einzigartig Neues in der Welt erschienen ist.“ – Hannah Arendt