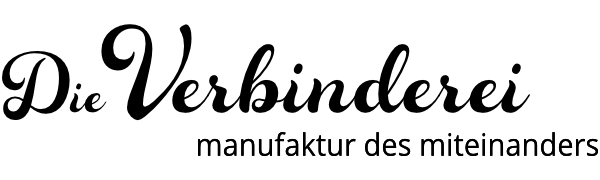15 März Versatzstück 20140315
Erlernte Hilflosigkeit
___
Theorien, die dem Denken Richtung geben
Der Begriff der erlernten Hilflosigkeit bezeichnet einen Zustand, in dem ein Individuum das Auftreten bedrohlicher Ereignisse als unkontrollierbar erlebt. Aus der Erfahrung, dass in wiederholter Weise solche Situation weder zu vermeiden noch zu verändern sind, resultiert die Hilflosigkeit.
Das Konzept hat seine Wurzeln in Tierexperimenten. In den 1970er Jahren konnte nachgewiesen werden, dass Ratten, die einen Elektroschock vorhersehen konnten (aufgrund eines vorhergehenden Signals) oder kontrollieren konnten (aufgrund der Bewegung in einem Laufrad), weniger Magengeschwüre entwickelten, als die Ratten, denen jede Vorhersehbarkeit und Kontrollmöglichkeit genommen wurde.
Ähnliche Ergebnisse zeigten sich bei Hunden. Hier konnte eine Gruppe die Elektroschocks vermeiden durch das Drücken eines Hebels oder das Überspringen einer Barriere. Einer zweiten Gruppe hatte keine Möglichkeit dazu. Mit beiden Gruppen wurde anschließend ein Training absolviert, bei dem die Hunde lernen sollten, sich bei der Ankündigung eines Elektroschock an einen bestimmten Platz zu begeben. Während die erste Gruppe gut trainierbar war und so den angekündigten Elektroschocks entging, ergaben sich die Tiere der zweiten Gruppe den schmerzhaften Reizen.
Neben den Tierexperimenten gab es natürlich auch Experimente mit Menschen – ohne Elektroschocks. Die Versuchsanordnung war wesentlich einfacher. Sie war aber nicht weniger aussagekräftig. Die Probanden wurden in zwei Gruppen unterteilt. Die eine bekam unlösbare Puzzle-Aufgaben. Die andere bekam lösbare Puzzle-Aufgaben. Zudem gab es eine Kontrollgruppe, die andere Aufgaben erhielt. Anschließend wurde untersucht, wie die Teilnehmer in einer zweiten Phase eine lösbare Puzzle-Aufgabe bewältigten. Die Teilnehmer der ersten Gruppe zeigten nun signifikant schlechtere Ergebnisse.
Und wie lässt sich dem entgegenwirken? Mit dem Eintreten der Hilflosigkeit schwindet in der Regel auch das Selbstwertgefühl. Die meisten Menschen schreiben sich selbst und nicht der Umwelt ein Versagen zu. Um hier wieder zu einem positiven Selbstbild zu kommen, hilft ein Training der Selbstwirksamkeitserwartung. Ganz ähnlich machen es übrigens auch viele Fußballmannschaften, wenn sie vor dem Saisonstart mit Benefiz- und Freundschaftsspielen gegen unterklassige Gegner beginnen. So kommen sie in der Regel in eine gute Verbindung zu sich selbst.
Das hilft natürlich nur, wenn anschließend auch tatsächlich Einflussmöglichkeiten vorhanden sind, die dann aufgrund der verbesserten Selbstwirksamkeitserwartung auch genutzt werden können.