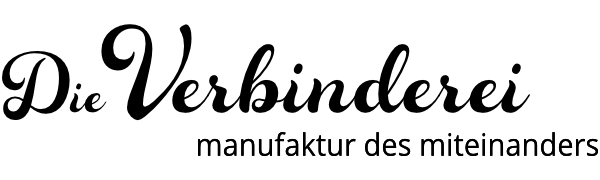15 Feb. Versatzstück 20150215
Gelernte Sorglosigkeit
___
Theorien, die dem Denken Richtung geben
Pessimisten nerven! Optimisten sind gefragt! Schau nach vorne! Alles wird gut! Stell Dich nicht so an! Was soll schon passieren? Eine unpassende Schwarzseherei ist unpassend. Eine unpassende Sorglosigkeit ist es allerdings auch!
Optimismus wird in der Regel positiv konnotiert und erwartet. Kaum jemand fragt, ob er angemessen ist. Allein die Frage scheint vielerorts geradezu verboten. Doch auch mit dem Glauben an eine gute Zukunft kann man es tatsächlich übertreiben. Das wird offenkundig bei allen, die nicht aus Not sondern aus Überzeugung überhöhte Risiken eingehen und Gefahren ignorieren. Doch wie kommt es dazu?
Eine Ursache: Menschen, die bei anderen sehen oder selbst die Erfahrung machen, dass ohne großen Aufwand durch riskantes Handeln überdurchschnittliche Erfolge möglich sind und dieses Handeln ohne nachteilige Folgen bleibt, erlernen eine Sorglosigkeit, die ihre Erwartungen prägen und ihre Entscheidungen beeinflussen – bis zur Erfahrung des Gegenteils.
Zum Beispiel am Finanzmarkt, im Umgang mit Technik oder auch im Sport ist dieses Verhalten bekannt. Die Akteure bleiben dann mit den vergangenen Erfahrungen zu stark verbunden und tendieren zu einer Selbstüberschätzung. Ein unbeteiligter Beobachter mag den unrealistischen Optimismus erkennen. Die handelnde Person jedoch nicht.
Gibt es auch ein Form von gesellschaftlicher Sorglosigkeit, einen kulturell verankerten Überoptimismus, der sich zum Beispiel in Bezug auf Themen wie Krieg und Klima als eine Art Kontrollillusion erweist? Und falls ja, woher soll hier eine realistischere Einschätzung kommen, wenn Zeitzeugen nicht mehr oder noch nicht vorhanden sind, die ihre Erlebnisse im unmittelbaren Austausch von Angesicht zu Angesicht weitergeben? Sind die Vertreter des nackten Wissens über die Vergangenheit und einer möglichen Zukunft einflussreich genug? Oder ist es vielleicht die Rolle der Kultur- und Medienschaffenden hier die berührenden Erinnerungs- und Erfahrungsangebote zu erzeugen?