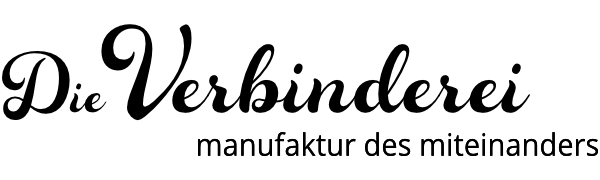15 Nov. Versatzstück 20151115
Niklas Luhmann
___
Menschen, die eine Unterscheidung gesetzt haben
Wenn es einen Nobelpreis für Soziologie gäbe, dann wäre Niklas Luhmann, geboren 1928, sicherlich bereits zu Lebzeiten ein aussichtsreicher Kandidat gewesen.
Die Darlegungen von Niklas Luhmann sind ohne Zweifel lohnenswert – aber auch harte Kost. Niklas Luhmann selbst schreibt: „Die Problematik liegt darin, dass die Begriffe zirkulär sind und ich immer etwas voraussetzen muss, was ich erst später erläutere.“
Doch genau in der Beachtung dieses Umstands, dass es beim Eintauchen in die Welt keinen Anfang gibt, von wo aus sie sich Stück für Stück erschließt, sondern alles in einem Zusammenspiel aus Wechselwirkungen existiert und aus diesen hervorgeht, liegt eine der Stärken der Systemtheorie von Niklas Luhmann.
Der Begriff der Kommunikation ist für Niklas Luhmann dabei von zentraler Bedeutung. In diesem Zusammenhang widmet er sich unter anderem den Verbreitungsmedien und skizziert die mit ihrer Nutzung einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen:
- Die Sprache. Durch die Sprache entsteht eine zweite Welt. Etwas kann sprachlich anders adressiert werden, als es sich bei seiner Anschauung zeigt – ja sogar ohne dass es sich überhaupt zeigt. Die Mitteilung, dass man einen dort liegenden Stein werfen kann, ist etwas anderes, als einen dort liegenden Stein zu betrachten. Und die Mitteilung, dass man Steine werfen kann, ist auch ohne die Anwesenheit von Steinen möglich. Damit kommt es zu einer Differenz zwischen der Welt aus Wörtern und der Welt aus Wahrnehmungen. Wer sie so beherrscht, wie die Gruppe, die sie nutzt, der findet Anschluss.
- Die Schrift. Mit der Schrift wird die akustische Kommunikation um eine optische erweitert. Mitteilungen lassen sich nun über den Kreis der Anwesenden hinaus transportieren, aufbewahren und aktualisieren. Größere Gesellschaften werden möglich. Das in der Sprache übliche Verschwinden der Wörter und Aussagen endet. Informationen verlieren ihre Vergänglichkeit. Die abrufbare Vergangenheit wird größer und sicherer. Der Mensch als Träger des Wissens verliert an Bedeutung. Der griechische Philosoph Platon sah in der Nutzung der Schrift allerdings ein Erkalten der Gesellschaft, weil Wissen nun nicht mehr nur von Mensch zu Mensch überliefert wird.
- Der Buchdruck. Die Einführung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern im 15. Jahrhundert war der Aufbruch in eine neue Epoche. Die Alphabetisierungsrate steigt. Sie erreicht aber erst im 20. Jahrhundert in Europa wirklich alle Bevölkerungsgruppen. Das Lesen wird zu einer gefährlichen Sache. Lesende Menschen entwickeln Meinungen. Ihr erworbenes Wissen kann handlungsleitend werden. Der Bedarf nach Inbezugsetzung des Wissens durch Vergleich und Reflexion – und damit nach Bildung – wächst. Bücher kennen, anders als ein Erleben, keine Gleichzeitigkeit. Mit ihrer Verbreitung wird in großer Breite eine lineare Ordnung des Denkens eingeübt, die nicht deckungsgleich ist mit der Praxis des Handelns.
- Die elektronischen Medien. Sie verändern die Welt erneut. Das Fernsehen transportiert die Macht der beweglichen Bilder. Sie liefern eine Art Realitätsgarantie. Der Beobachter wird Zeuge der Abläufe. Mit dem Internet verschwindet schließlich die zeitliche Versetzung auf breiter Front. Alles ist jetzt. Im Streit der Meinungen ist jede Aussage für jeden prüfbar und kommentierbar. Mit der Computerisierung und Vernetzung greifen zudem nun auch Algorithmen als Akteure in die Kommunikationen ein. Programme setzen Entscheidungsvorgaben, die über Maschinen oder Menschen an den Mann oder die Frau gebracht werden. Für die Inhalte gibt es keinen greifbaren Urheber mehr, außer „das System“. Es sind Angebote zur Akzeptanz oder Ablehnung ohne Dialoginteresse. Selbst die für die Generierung der Angebote Verantwortlichen kennen oft nicht mehr die Regeln, nach denen sie genau zustande kommen.
Jedes neue Verbreitungsmedien eröffnet Möglichkeit über den Rahmen der bisherigen Möglichkeiten hinaus. Dieser Referenzüberschuss ist zu bewältigen. Er verändert die Gesellschaft, indem er ihre Mitglieder dazu auffordert, neuen Unterscheidungen Beachtung zu schenken.
Was sind beispielsweise Geburtstags- oder Weihnachtsgrüße wert, die eine Maschine erstellt und verschickt, ohne dass ihr Absender auch nur eine Minute seiner Lebenszeit in ihre Erstellung investiert hat? Wer grüßt hier? Welchen Stellenwert messen wir einer elektronischen Zugdurchsage zu, die sich entschuldigt und um Verständnis bittet für eine Verspätung? Wer entschuldigt sich hier? Noch Leben wir in vielen Bereich von den Erinnerungen an alte Entstehungsvorgänge und Urheber – doch das ändert sich.